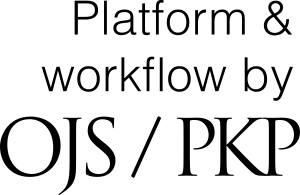Archiv
-
Teachers for Social Justice: Centering Pre-Service Teachers’ Perspectives in Critical English Language Education
Bd. 7 Nr. 2 (2025)This special issue contains the work of eight authors who were at the time of writing their articles pre-service teachers (most of them specifically: students) of English Language Education at Bielefeld University. The authors started to focus on Critical English Language Education in various moments during their professionalisation, from very early in their Bachelor studies to later on in their Master degree programmes. They all, however, have one common goal: to better understand, analyse and reshape the discource dedicated to questions of social justice and teacher education. The articles represent both empirical research on the ways both in-service and pre-service teachers position themselves towards social justice education and conceptual research that shows at the example of various analog and digital materials how English language lessons can relate to social justice topics.
-
PraxisForschungLehrer*innenBildung – Ausgabe 7
Bd. 7 Nr. 1 (2025)Dies ist die reguläre Ausgabe des Jahres 2025. Sie versammelt Einzelbeiträge zu unterschiedlichen Themen. Im Sinne eines Open Online Journals werden im Laufe des Jahres regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht.
-
Aufgabenkultur als Rahmung und Mittel heterogenitätssensiblen Unterrichtens
Bd. 6 Nr. 3 (2024)Dieses Themenheft dokumentiert die Bielefelder Frühjahrstagung 2023, die sich als Nachwuchstagung umfänglich mit dem Thema „Aufgaben und Aufgabenkultur“ aus der Perspektive der Lehrer*innenbildung und der Bildungsforschung beschäftigte. Die einzelnen Beiträge befassen sich mit verschiedenen Aufgabentypen, fachspezifischen Aufgabenkulturen sowie empirischer Forschung zu Aufgaben in den Fachdidaktiken Mathematik, Sport sowie Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und verdeutlichen damit fachliche Differenzen von Aufgaben und ihre Bedeutung für heterogene Lerngruppen.
-
Adaptive Lernunterstützung im Fachunterricht: generische und fachdidaktische Perspektiven
Bd. 6 Nr. 2 (2024)Mit Heterogenität in Schule und Unterricht pädagogisch angemessen umzugehen und allen Schüler*innen in heterogenen Lerngruppen zu ermöglichen, zentrale Bildungsziele zu erreichen, sind die größten Herausforderungen für die Schule. Unterrichtsforschung und Schulentwicklung nehmen deshalb verstärkt individualisierte bzw. personalisierte Lehr-Lern-Prozesse in den Blick. Erweiterte Anforderungen, die sich daraus für die Lehrpersonenaus- und -weiterbildung ergeben, betreffen die Frage, wie Lehrpersonen bestmöglich auf einen angemessenen Umgang mit Heterogenität vorbereitet werden können. Das vorliegende Themenheft beinhaltet Beiträge, die sich auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln der Frage nähern, was unter einer fachpädagogisch und kommunikativ gehaltvollen adaptiven Lernunterstützung zu verstehen ist und was es dafür auf der Planungsebene braucht, damit eine solche Unterstützung im Unterricht umgesetzt werden kann.
-
PraxisforschungLehrer*innenBildung – Ausgabe 6
Bd. 6 Nr. 1 (2024)Dies ist die reguläre Ausgabe des Jahres 2024. Sie versammelt Einzelbeiträge zu unterschiedlichen Themen. Im Sinne eines Open Online Journals werden im Laufe des Jahres regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht.
-
Standards – Margins – New Horizons. Canons for 21st-century Teaching
Bd. 5 Nr. 3 (2023)Das Themenheft dokumentiert die Beiträge der gleichnamigen Konferenz , die im Frühjahr 2022 an der Universität Bielefeld stattfand. Diese stellen die Fortsetzung der ersten New Horizons-Konferenz vom Frühjahr 2019 dar, die 2020 als Themenheft der Zeitschrift PFLB (4. Jg., H. 2) dokumentiert wurde. Die Beiträge der „New Horizons II“ diskutieren die Frage, welche sprachlichen, literarischen und kulturellen Kanones für den Fremdsprachenunterricht des 21. Jahrhunderts in den neuen und alten Sprachen maßgeblich sein sollten. Sie widmen sich dabei auch der Problemstellung, welche impliziten und expliziten Kanones derzeitig ausgemacht werden können, welche Akteur*innen diese propagieren und welche Machtstrukturen daraus ersichtlich werden. Die Beiträge überlegen weiterhin, welche Kriterien und Leitlinien für die Canons for 21st-century Teaching genutzt werden können sowie welche konkreten Texte dabei in den Blick geraten. Übergreifend fragen die Beiträge außerdem, was fremdsprachliche Bildung im 21. Jahrhundert bedeutet und welche professionstheoretischen Implikationen sich daraus ergeben. Die neunzehn Beiträge sind in vier Sektionen gegliedert: Critical Literacy, Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik, Sprache und Sprachvariation sowie Digitalität.
-
„verschieden vielfältig“ – Relevanz von Diversität im Kontext von (Lehrer*innen-)Bildungsforschung
Bd. 5 Nr. 2 (2023)Vielfalt wahrnehmen, anerkennen und mit ihr umgehen zu können, erfordert gerade im Kontext von Lehrer*innenausbildung, Bildungsforschung und der Förderung des fachdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Nachwuchses Diversitätssensibilität von allen Beteiligten auf verschiedenen Ebenen. Das Themenheft „verschieden vielfältig – Relevanz von Diversität im Kontext von (Lehrer*innen-)Bildungsforschung“ dokumentiert die Bielefelder Frühjahrstagung 2022, die sich als Nachwuchstagung umfänglich mit dem Phänomen Diversität aus der Perspektive der Lehrer*innenbildung und der Bildungsforschung beschäftigte.
-
PraxisForschungLehrer*innenBildung – Ausgabe 5
Bd. 5 Nr. 1 (2023)Dies ist die reguläre Ausgabe des Jahres 2023. Sie versammelt Einzelbeiträge zu unterschiedlichen Themen. Im Sinne eines Open Online Journals werden im Laufe des Jahres regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht.
-
Forschungskompetenz in der Lehrkräftebildung – Evaluation eines Seminarkonzepts
Bd. 4 Nr. 4 (2022)In diesem Themenheft wird ein Seminarkonzept vorgestellt, das den Aufbau und die Förderung von Forschungskompetenz Lehramtsstudierender zum Ziel hat. Das übergeordnete Ziel des Themenheftes besteht darin, das für die universitäre Lehrkräfteausbildung entwickelte Seminarkonzept aus verschiedenen theoretischen wie praktischen Perspektiven zu beleuchten. So konnten neben der im Experimentaldesign durchgeführten Erforschung der Wirksamkeit des Seminars und einer begleitenden Evaluation für das vorliegende Themenheft auch Expert*innen gewonnen werden, die in theoretischen Beiträgen einen Überblick über die Profession des Lehrberufs, das Konzept des Forschenden Lernens im Bereich der Lehrkräfteausbildung sowie die Bedeutsamkeit von Forschung und Evidenz für Lehrkräfte geben.
-
Freundschaften und prosoziale Peer-Kontakte in der Schule
Bd. 4 Nr. 5 (2022)Dieses Themenheft richtet den Blick auf die soziale Funktion von Schule als Ort der jugendlichen Vergemeinschaftung. Diese Funktion konnte Schule insbesondere in der Corona-Pandemie nur unzureichend erfüllen. Anstrengungen, Corona-bedingte Defizite durch das Wegbrechen von Schule als Erziehungs- und Bildungsraum beziehungsweise als Lern- und Sozialraum zu kompensieren, fokussieren oftmals einseitig auf das Bemühen, fachliche Defizite auszugleichen. Das Themenheft befasst sich zunächst mit den psychologischen und sozialkognitiven Voraussetzungen für die Aufnahme von Freundschaften und Peerbeziehungen, wie etwa Empathie und Perspektivenübernahme, und damit, welche Werte und Eigenschaften Jugendlichen bei ihren Freund*innen wichtig sind. In einem darauffolgenden Beitrag werden interethnische Peerbeziehungen im Spannungsfeld zwischen Freundschaften und Segregation vorgestellt. Ein weiterer Themenblock befasst sich mit den Zusammenhängen zwischen (interethnischen und interreligiösen) Freundschaften und Peerkontakten in der Schule und anderen Variablen, nämlich den Lernergebnissen, schulischem Wohlbefinden und prosozialen Einstellungen oder Abgrenzungsbestrebungen. In einer qualitativen Interviewstudie wird der Blick der Lehrkräfte auf (interethnische) Freundschaften und Peerbeziehungen im Schulkontext gerichtet. Die Möglichkeiten der Förderung von Freundschaften und positiven Peerkontakten in der Schule allgemein sowie im Speziellen als Aufgabe des Religionsunterrichts sind die Themen des letzten Blocks.
-
Beratung und Supervision in der Bildung von Lehrer*innen
Bd. 4 Nr. 3 (2022)Beratung und Supervision scheinen methodisch und systematisch jene Lücke zu füllen, die sich ergibt, wenn von Lehrkräften verlangt wird, die sich eröffnenden schulpädagogischen Handlungsoptionen insbesondere hinsichtlich der Förderung oder Einschränkung möglicher Lern- und Bildungsprozesse von Schüler*innen vor dem Hintergrund bestehender und erworbener Wissensbestände zu reflektieren. In diesem Zusammenhang werden zunehmend beratende Tätigkeiten insbesondere auch im Rahmen der Diskurse und Bemühungen um Kooperation, Diversität, Inklusion und multiprofessionelle Zusammenarbeit über alle drei Phasen der Lehrer*innenbildung hinweg adressiert und damit auch verstärkt Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen. Mit dem vorliegenden Themenheft, welches Beiträge der gleichnamigen Tagung aus dem Jahr 2021 dokumentiert, werden von den Autor*innen theoretisch-systematische und empirische Erkundungen vorgenommen, die vor allem auch aktuelle Entwicklungen und Maßnahmen in der Lehrer*innenbildung darstellen und reflektieren.
-
Demokratiebildung als (hoch-)schulische Querschnittsaufgabe und demokratisch-politische Bildung als Prinzip der Lehrer*innenbildung, Teil 2
Bd. 4 Nr. 2 (2022)Im zweiten Teil des Themenheftes „Demokratiebildung als (hoch-)schulische Querschnittsaufgabe und demokratisch-politische Bildung als Prinzip der Lehrer*innenbildung“ liegt der Schwerpunkt auf der Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Demokratie und Inklusion, wobei von einem sehr weiten Inklusionsverständnis ausgegangen wird.
Dieser zweite Teil des Themenheftes umfasst Beiträge von Bielefelder Wissenschaftler*innen, die sich in Form von Workshops und Impulsvorträgen an der Prä-Konferenz „Demokratie braucht Inklusion“ (Motto des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel) der Bielefelder Frühjahrstagung 2021 beteiligt haben.
Der erste Teil (Jg. 3/2021, H. 3) umfasst vor allem Beiträge von Bielefelder Wissenschaftler*innen, die an der Initiative „Demokratisch-politische Lehrer*innenbildung“ (DePoLe) der Bielefeld School of Education beteiligt sind. Dort findet sich auch eine Einführung in die Gesamtkonzeption der beiden Hefte sowie sämtliche Beiträge.
-
PraxisForschungLehrer*innenBildung – Ausgabe 4
Bd. 4 Nr. 1 (2022)Dies ist die reguläre Ausgabe des Jahres 2022. Sie versammelt Einzelbeiträge zu unterschiedlichen Themen. Im Sinne eines Open Online Journals werden im Laufe des Jahres regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht.
-
Selbstdeutung, Positionierung & Rollenfindung: Zum Selbst in der universitären Lehrer*innenbildung
Bd. 3 Nr. 5 (2021)Das Themenheft widmet sich einem Problem, das für jedwede (pädagogische) Lehrpraxis vorliegt: die Selbstpositionierung und Rollenfindung als Lehrende*r. Für den schulischen Lehrberuf ist dies viel diskutiert – für den hochschulischen Komplex, insbesondere in der Lehrer*innenbildung, lässt sich hier jedoch von einem Desiderat sprechen. Die Selbstpositionierung und Rollenfindung als Hochschullehrer*in scheinen nicht nur durch die allgemeine Fachkultur und das disziplinäre Selbstverständnis geprägt, sondern auch auf individuelle Repräsentant*innen und diese wiederum auf etwas Allgemeines angewiesen, an dem sie sich orientieren können. Dieser Verwobenheit von biographischen Erfahrungen mit Entwicklungslinien der jeweiligen Disziplin spürt das Themenheft nach. Es vereint unterschiedliche Selbstpositionierungen etablierter Hochschullehrer*innen als Lehrende der Lehrer*innenbildung. Entstanden sind individuelle – persönliche und abstrakte, (auto-)biografische und theoretische – Zugriffe auf ein diffuses Problem, die ein Bild von den Differenzen der selbstbezüglichen Positionierungsnotwendigkeiten in der universitären Lehre zu vermitteln imstande sind. Schließlich bietet das Themenheft Impulse für die Ausweitung eines bisher eher marginal thematisierten Aspekts des hochschuldidaktischen und -theoretischen lehrer*innenbildungsspezifischen Diskurses über die Rolle als Lehrende*r.
-
Selbstständigkeit als pädagogischer Horizont der Oberstufe: Eine qualitative Untersuchung zum Verständnis von Selbstständigkeit in der pädagogischen Praxis der Eingangsphase am Oberstufen-Kolleg
Bd. 3 Nr. 4 (2021)Diese Publikation widmet sich den Fragen, welche Kompetenzen in Bezug auf Selbstständigkeit von den Schüler*innen im Verlauf der Eingangsphase des Oberstufen-Kollegs erwartet werden, welches Verständnis von Selbstständigkeit die Akteur*innen der Eingangsphase aufweisen, welche Konzepte zur Förderung von Selbstständigkeit von ihnen verfolgt werden und welche Herausforderungen sich hierdurch sowie durch die institutionellen Strukturen für die Schüler*innen ergeben. Dazu wird zunächst Selbstständigkeit als pädagogischer Horizont theoretisch beschrieben und mit den drei Begriffen der produktiven, funktionalen und instrumentellen Selbstständigkeit ausdifferenziert. Der hierbei neu eingeführte Begriff der instrumentellen Selbstständigkeit eröffnet mit dem Konzept der „Zone der nächsten Entwicklung“ auf Basis der Arbeiten Wygotskis (1987) den Blick auf konkrete Lernprozesse, die durch Lernende selbst und mit professioneller Unterstützung initiiert werden. Die instrumentelle Selbstständigkeit wird anschließend auf eine, aus den Arbeiten Ludwig Hubers (1994, 1998, 2010) abgeleitete Vorstellung von Studierfähigkeit bezogen. Dieser theoretische Rahmen wird um eine Darstellung institutioneller Strukturen für das Selbstständigwerden auf verschiedenen Ebenen (KMK, NRW, Oberstufen-Kolleg) sowie um eine Darstellung der Unterrichtsstrukturen am Oberstufen-Kolleg ergänzt. Unter Berücksichtigung dieser theoretischen Überlegungen werden leitfadengestützte Interviews mit verschiedenen Akteur*innen aus der pädagogischen Praxis der Eingangsphase (Lehrende verschiedener Basiskurse, Schulsozialarbeit, Laufbahnberatung, Projektkoordination) nach der Methode des thematischen Kodierens ausgewertet. Dabei werden verschiedene Vorstellungen zu einer pädagogischen Hinführung zur Selbstständigkeit entfaltet und systematisch auf die Ebenen des Unterrichts und der Institution bezogen.
-
Demokratiebildung als (hoch-)schulische Querschnittsaufgabe und demokratisch-politische Bildung als Prinzip der Lehrer*innenbildung, Teil 1
Bd. 3 Nr. 3 (2021)Demokratie wird immer wieder aufs Neue auf den Prüfstand gestellt, sei es durch Wahlsiege rechtspopulistischer Parteien oder durch die aktuelle „Corona-Krise“. Vor diesem Hintergrund ist das Erlernen und Erleben von Demokratie insbesondere für die heranwachsende Generation zentral, woraus sich für Schule und Unterricht die Querschnittsaufgabe Demokratiebildung ergibt. Anzusetzen ist dabei auch bei den (zukünftigen) Lehrkräften.
Das Themenheft ist aus der Initiative „Demokratisch-politische Lehrer*innenbildung“ der Bielefeld School of Education und der Bielefelder Frühjahrstagung 2021 hervorgegangen, die sich in ihrem Rahmenprogramm dem Thema „Demokratieförderung – Rolle und Verantwortung fachlicher Bildung und (hoch-)schulischer Praxis!?“ widmete. Es umfasst Beiträge von Bielefelder Wissenschaftler*innen, die an der Initiative und/oder der Bielefelder Frühjahrstagung 2021 beteiligt sind/waren.
Aus unterschiedlichen Perspektiven wird erörtert, was Demokratiebildung und -förderung im und für Unterricht bedeuten und welche Implikationen sich für die Lehrer*innenbildung ergeben. Neben fachlichen Basisbeiträgen, die eine begriffliche Systematik bieten, enthält das Heft Beiträge unterschiedlicher Fächer bzw. Fachdidaktiken. In ihnen wird dokumentiert, was in der universitären Lehrer*innenbildung bereits zu demokratisch-politischer Bildung unter unterschiedlichen Überschriften und Formaten stattfindet.
In einem zweiten Teil dieses Themenheftes (Jg. 4/2022, H. 2) sind Beiträge von Bielefelder Wissenschaftler*innen veröffentlicht, die sich in Form von Workshops und Impulsvorträgen an der Prä-Konferenz „Demokratie braucht Inklusion“ der Bielefelder Frühjahrstagung 2021 beteiligt haben. -
Pädagogische Beziehungen und Anerkennung – Perspektiven aus den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften
Bd. 3 Nr. 2 (2021)Das Themenheft „Pädagogische Beziehungen und Anerkennung – Perspektiven aus den Fachdidaktiken und Bildungswissenschaften“ dokumentiert die Bielefelder Frühjahrstagung 2020. Es umfasst Beiträge von Bielefelder Wissenschaftler*innen sowie von geladenen Expert*innen, die diese Tagung in Form von Vorträgen und Forschungswerkstätten unterstützt haben. Der Fokus der einzelnen Beiträge liegt auf der jeweiligen fachdidaktischen oder bildungswissenschaftlichen Perspektive bezogen auf Pädagogische Beziehungen und Anerkennung und reflektiert diese kritisch.
-
PraxisForschungLehrer*innenBildung – Ausgabe 3
Bd. 3 Nr. 1 (2021)Dies ist die reguläre Ausgabe des Jahres 2021. Sie versammelt Einzelbeiträge zu unterschiedlichen Themen. Im Sinne eines Open Online Journals werden im Laufe des Jahres regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht.
-
Schulische Bildung in Zeiten der Pandemie. Befunde, Konzepte und Erfahrungen mit Blick auf Schul- und Unterrichtsorganisation, Bildungsgerechtigkeit und Lehrpraxis
Bd. 2 Nr. 6 (2020)Die Leser*innen dieses Themenheftes erwartet eine sehr breite Sammlung von quantitativ und qualitativ ausgerichteten empirischen Studien, rekonstruktiven Analysen, theoriegeleiteten Erörterungen und praxisnahen Erfahrungsberichten. Demnach geht es in diesem Themenheft darum, sowohl den empirisch-wissenschaftlichen als auch den praxisnahen Diskurs zu ermöglichen, um so kritisch-konstruktive Reaktionen und Umgangsweisen mit der besonderen Situation im Schuljahr 2020/21 zu befördern. Neben Überblicksstudien und -reflexionen finden sich Beiträge zu den Themenkomplexen "Bildungsbenachteiligung und -gerechtigkeit" und "Schulorganisation & Home-School-Organisation" sowie "Praxisbeispiele für den Umgang mit der Krise". "Digitalisierung" und "Didaktik" erweisen sich dabei bedeutsame als Querschnittsthemen.
-
Gesundheit, Zufriedenheit und Belastung in Lehrer*innenbildung und -beruf. Exemplarische Studien zu wenig beachteten Phänomenen
Bd. 2 Nr. 5 (2020)In diesem Themenheft sind fünf Beiträge zusammengefasst, die sich der Gesundheit, Belastung und Arbeitszufriedenheit von Lehrkräften unter thematischen, theoretischen oder methodischen Schwerpunktsetzungen widmen, die bisher in den relevanten Diskursen eher wenig Beachtung fanden. So wird z.B. in einem der Beiträge untersucht, was Lehrkräfte dazu bringt, trotz teilweise schwieriger Bedingungen in ihrem Beruf zu bleiben. Insgesamt illustrieren die Beiträge exemplarisch die Potenziale ihrer noch neuen Zugänge. Gerahmt werden sie durch ein Editorial, in dem eine Einordnung in den aktuellen Stand von Theorie und Empirie stattfindet.
-
Standards – Margins – New Horizons. Teaching Language and Literature in the 21st Century
Bd. 2 Nr. 4 (2020)Wenn man sowohl die Forderungen der New London Group als auch die jüngeren Ansprüche an das Lehren und Unterrichten in heterogenen Gruppen ernst nimmt, dann besteht die Aufgabe von Lehrer*innen zunehmend darin, eine Vielfalt von Lernenden auf eine wachsende Vielfalt in allen Lebensbereichen vorzubereiten, indem sie mit einer Bandbreite unterschiedlicher Inhalte konfrontiert werden. Zur Diskussion dieser Fragen haben die Gast-Herausgebenden dieses Heftes zu einer Tagung „Standards – Margins – New Horizons: Teaching Language and Literature in the 21st Century“ eingeladen. Der innovative Fokus auf die Kombination von Latinistik und Anglistik ergab sich aus folgenden Überlegungen: Englisch als moderne und Latein als antike Lingua Franca sind bzw. waren Kommunikations- und Ausdrucksmittel für verschiedene Kulturen und Epochen und gewähren zahlreichen Ausdrucksformen von Diversität in Sprache und Literatur Raum. Gleichzeitig spielen die Themen Diversität und Multiliteracies in beiden Fachdidaktiken aktuell eine große Rolle, auch wenn sie teils sehr unterschiedlich diskutiert werden. Dieses Spannungsverhältnis aus Gemeinsamkeiten und verschiedenen Perspektiven sollte zum gegenseitigen Vorteil genutzt werden. Komplementiert wurde der interdisziplinäre Dialog durch Beiträge aus Romanistik und Musikpädagogik. Das Ergebnis dieses intensiven Austauschs sind die Beiträge in diesem Themenheft.
-
Forschungsperspektiven auf Unterricht im Spannungsfeld von Kontingenz und Kontinuität
Bd. 2 Nr. 3 (2020)Die Bielefelder Frühjahrstag 2019 zielte auf eine „reflexive Beschäftigung mit Ungewissheit“ (Frei & Körner, 2010, S. 9) ab. Kontingenz und Kontinuität wurden auf der methodischen und methodologischen Ebene sowie auch theoretisch systematisch in den Blick genommen. Das vorliegende Themenheft dokumentiert den Diskurs. Es umfasst Beiträge von Bielefelder Wissenschaftler*innen sowie von geladenen Expert*innen, welche die Tagung in Form von Vorträgen und Forschungswerkstätten unterstützt haben. Der Fokus der einzelnen Beiträge liegt auf der jeweiligen Forschungsperspektive auf Unterricht im Spannungsfeld von Kontingenz und Kontinuität.
-
Der Basiskurs Naturwissenschaften am Oberstufen-Kolleg Bielefeld
Bd. 2 Nr. 2 (2020)Der Basiskurs Naturwissenschaften wurde von einer Gruppe aus Lehrenden, Bildungsforscher*innen und Fachdidaktiker*innen als einjähriger Kurs mit vier Wochenstunden in der Eingangsphase der Oberstufe am Oberstufen-Kolleg Bielefeld entwickelt, langjährig erprobt, evaluiert und iterativ weiterentwickelt. Der Kurs ist so angelegt, dass er grundlegende naturwissen-schaftliche Denkweisen (vgl. Scientific Literacy) und naturwissenschaftliche Methoden (vgl. Scientific Inquiry) mit einem Fokus auf steigende Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Kollegiat*innen adressiert und nicht in erster Linie auf fachinhaltliche Vollständigkeit abzielt. Im Zentrum des Kurskonzeptes steht der hypothetisch-deduktive Erkenntnisweg, der von den Kollegiat*innen v.a. mithilfe einer Reihe von Schülerexperimenten durchdrungen werden soll. Das vorliegende Themenheft bietet eine Zusammenstellung von konzeptionellen Beiträgen, die Gestaltungsprinzipien und konkrete Umsetzungen für die einzelnen Unterrichtsmodule beschreiben, und Beiträgen, die erste qualitative und quantitative Befunde zur Durchführung und Evaluierung des Kurses sowie erste Rückmeldungen aus Lehrerfortbildungen fokussieren.
-
PraxisForschungLehrer*innenBildung – Ausgabe 2
Bd. 2 Nr. 1 (2020)Dies ist die reguläre Ausgabe des Jahres 2020. Sie versammelt Einzelbeiträge zu unterschiedlichen Themen. Im Sinne eines Open Online Journals werden im Laufe des Jahres regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht.
-
Forschendes Lernen in Bielefeld – fachdidaktische Profile
Bd. 1 Nr. 2 (2019)Das Heft „Forschendes Lernen in Bielefeld – fachdidaktische Profile“ widmet sich den Adaptionen des hochschuldidaktischen Konzepts Forschenden Lernens der Bielefelder Fachdidaktiken. Den sechzehn fachdidaktischen Darstellungen der jeweiligen Programme voran stehen vier Beiträge, die sowohl inhaltliche als auch generative sowie hochschuldidaktische Einordnungen leisten. Die letzten beiden Beiträge leisten eine konzeptionelle Verortung sowie neoinstitutionelle Deutung der Adaptionen.
-
PraxisForschungLehrer*innenBildung – Ausgabe 1
Bd. 1 Nr. 1 (2019)Dies ist die reguläre Ausgabe des Jahres 2019. Sie versammelt Einzelbeiträge zu unterschiedlichen Themen. Im Sinne eines Open Online Journals werden im Laufe des Jahres regelmäßig neue Beiträge veröffentlicht.